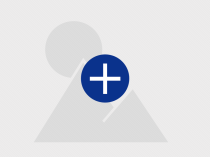Die Geschichte der Ampel
Die wichtigsten Ereignisse
Die Ampel ist älter als man denkt. Im Jahre 2014 wurde ihr 100er Geburtstag gefeiert. Aber ist das wirklich ihr Geburtstag gewesen? Und viele kennen den Ampelturm auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Ist er wirklich die erste Verkehrsampel Deutschlands gewesen? ...
Wir starten am 10. Dezember 1868...
Ja, man glaubt es kaum, doch die erste Ampel der Welt ist am 10. Dezember 2018 gute und stolze 150 Jahre alt geworden. Und hier beginnt die Geschichte, die den Straßenverkehr für immer verändern sollte. Der Name des Entwicklers war John Peake Knight. Er kam aus England und war Eisenbahningenuer. Seine Ampel bestand aus einer Gaslaterne, für die Scheiben eines Eisenbahnsignals verwendet wurden.
Unterhalb dieser Gaslaterne waren Arme installiert, die sich heben oder senkten, je nach dem, ob Halt oder Fahrt gegeben war. Waren die Arme senkrecht, bedeutet dies Halt. Im dunkeln war dabei das Rote Licht zu sehen. Zu der Zeit gab es kein Gelb im Straßenverkehr. Damals hieß Rot: Stopp!, Grün: Vorsicht!; und Weiß: Freie Fahrt. Die Ampel hatte nur Rot und Grün, also hieß demzufolge Grün, bzw. 45° abgesenkte Arme, dass man mit Vorsicht passieren durfte. Die Erfindung hielt nicht lange. Im Jahre 1869 explodierte die Gaslaterne. Die Ampel wurde von einem Verkehrspolizisten bedient, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde.
Im Jahre 1872 wurde die Anlage vollständig abgebaut. Ihr ehemaliger Standort war in London, in der Nähe des House of Parlaments. Dort ist heute eine Gedenktafel an John Peake Knight zu finden.
Eigens erstellte Skizze: So soll die Ampel ausgesehn haben!
1912 und 1914 in Amerika...
Im Jahre 1912 erfand ein Verkehrspolizist aus Utah die wahrscheinlich wirklich erste elektrische Verkehrsampel. Sie soll aus Holz mit gefärbten Leuchtmitteln bestanden haben. Auch diese musste von einem Verkehrspolizisten von Hand bedient werden.
1914 kam die Ampelanlage, die im Jahr 2014 als "100 Jahre Ampel" gefeiert wurde. Diese stand in Cleveland und bestand aus vier Signalgebern. Diese zeigten entweder das Wort "STOP" in Rot, oder "MOVE" in Grün. Besonderheit war, dass eine Feuerwehr in der Nähe war, die schon damals die Möglichkeit gehabt haben soll, alle Richtungen auf Rot zu stellen, um Einsatzfahrzeugen den Vorrang zu gewähren. Zusätzlich gab es ein Läutwerk an der Anlage, die den Anwurf, bzw. den Abwurf ankündigte.
1920, eine kleine Revolution in Amerika...
William L. Potts, ebenfalls ein Verkehrspolizist, enwickelte das erste sogenannte "Four-Way-Signal" mit Gelb in der Mitte. Bei dem Signal war die Farbdeutung schon so, wie wir sie heute kennen.
Eine Besonderheit dabei war, dass es in dem Signal nur drei Leuchtmittel gab. Dafür wurde an zwei Seiten die Front "verdreht", mit anderen Worten, Grün war oben, während auf den anderen zwei Seiten Rot oben war. So hatte beispielsweise die Hauptrichtung Grün, und dabei wurde automatisch gleichzeitig Rot in der Nebenrichtung gezeigt. Das Signal soll heute noch in einem Museum in Amerika zu sehen sein.
1922, Veränderung auf dem europäischen Festland...
1922 kam die Ampel nach Europa. Die allererste europäische Ampel soll in Paris gestanden haben. Kurz danach, noch im Jahre 1922 kam die aller erste Ampel nach Deutschland. Diese war allerdings nicht der Ampelturm, auf dem Potsdamer Platz. Die erste Ampel in Deutschland befand sich auf dem Stephansplatz in Hamburg.
1924... Jetzt ist Berlin dran.
1924 erwartete Berlin eine große Lieferung aus New York. Der Potsdamer Platz, schon damals ein Platz von hohen Verkehrsströmen geplagt, musste mit über 10 Verkehrspolizisten gleichzeitig geregelt werden. Dies änderte sich am 21. Oktober 1924. Die Lieferung aus New York war nämlich der mittlerweile berühmte Ampelturm. Damit diese Ampel ihrer Funktion gerecht werden konnte, wurde der Platz umgebaut. Ab da war nur noch ein Polizist nötig, der sich in der Kabine auf dem Turm befand. 1933 war Schluss mit der effektiven Verkehrsreglung auf dem Potsdamer Platz. Der Turm wurde abgerissen und verschrottet. Nach dem Krieg, verwandelte sich der Platz in ein reines Ödland, und dann ging auch noch die Berliner Mauer über den Platz.
1997 schlossen sich Siemens und Daimler zusammen, und bauten den Ampelturm nach. Seit dem steht er wieder auf dem Potsdamer Platz, regelt aber nicht mehr den Verkehr. Er ist ein Andenken. Im Jahre 2010 kam es tragischer Weise zu einem Unfall. Auf einem Markt, der auf dem Potsdamer Platz statt fand, fing eine Marktbude Feuer und zerstörte Teile des Turms. Die Stadt beauftragte die Sanierung, und im Jahr 2012 wurde der Turm erstmals wieder im vollen Glanz gesichtet.
1950 und 1960: die ersten Serienmäßigen Modelle...
.
Über die Signalgeber ist leider kaum was bekannt, dennoch gibt es Spuren und Anhaltspunkte, die die Geschichte dieser Signalgeber vermuten lassen. Ihr Hoch hatten sie in den 1950er und 1960er Jahren in der osthälfte Deutschlands und Berlin. Von innen sehen sie den später folgenden "DDR-Ampeln" sehr ähnlich, gerade die Installation der Lampenfassungen und die Art der Reflektoren, weshalb vermutet wird, dass die Signalgeber bereits in Wildenfels produziert wurden, wie später die DDR- Ampeln im VEB Wildenfels.
Auf einigen Archivbildern aus der Zeit 1950 bis 1960 sind solche Signalgeber in den Anlagen zzu finden gewesen. Auch in den 70er Jahren, in den in der DDR die Aluminium- Druckguss- Signalgeber erschienen, wurden die bestehen Anlagen mit diesen Signalgebern weiter betrieben. Sie erhielten maximal eine Aktualisierung, zum Beispiel durch den Einsatz der Ostampelmännchen.
In den 60 Jahren erschienen zumindest in der Westhälft Deutschlands neue Signalgeber. Signalbau Huber präsentierte ein neues Modell, und Siemens brachte den unter Sammlern beliebten Silumin raus. Die beiden Signalgeber wurden auch teilweise noch in den 70er produziert.
1961 werden zwei kleine Helden geboren.
Der Osten Deutschlands erlebte eine verkehrstechnische Revolution und schloss dabei zwei kleine Männchen ganz tief in ihr Herz: die Ampelmännchen
Karl Peglau ist der Name des Vaters. Er war Verkehrspsychologe in der DDR und vertrat die Meinung, dass sich Fußgänger eher angesprochen fühlen, wenn ein Männchen ihnen den Befehl zum Gehen oder Stehen gibt. Mit dieser Vision entwarf er das Ostampelmännchen. Es soll zwei Entwürfe des Männchens gegeben haben, wobei sich der zweite durchsetzte. In allen Fußgängersignalen der DDR war darauf hin dieses Männchen zu finden. Sogar im DDR- Fernsehen traten die beiden regelmäßig in der Sendung "Verkehrskompas" mit "Stiefelchen und Kompaskalle" auf, und gaben den Kindern wertvolle Tipps zum rücksichtsvollen und angemessenen Verhalten im Straßenverkehr. So leisteten die beiden auch einen wertvollen Beitrag zur Verkehrserziehung.
1961, meine Heimatstadt Dresden bekommt ihre erste Ampel...
Am 10. Dezember 1961 wurde die erste Lichtsignalanlage in Dresden in Betrieb genommen. Sie befand sich auf der Könneritzstraße/ Schweriner Straße. Installiert wurden die selben Signalgeber, die in den 50er Jahren vermutlich in Wildenfels produziert wurden. Auf einem Vorprung am Gebäude des Kraftwerk Mitte wurde die Steuerkabine aufgestellt. Dort war der Platz für Verkehrspolizisten, die das Verkehrsgeschehen im Auge behielten. Wie die Stadt berichtete, soll es schon 1960 Versuche einer Lichtsignalanlage am Albertplatz gegeben haben, diese schlugen allerdings fehl, weshalb die Könneritzstraße/ Schweriner Straße die erste wurde.
Nach dem Mauerfall baute Signalbau Huber (Swarco Traffic System) an diesem Ort eine neue Anlage, die nach dem Hochwasser 2002 neu gemacht wurde. An die alte LSA erinnert heute nichts mehr, außer der Leere Vorsprung auf dem Kraftwerksgebäude mit der Zugangstür in der Mauer. Lediglich die Stadt erinnert an die LSA: Die aktuelle LSA trägt heute immernoch die Anlagennummer "001".
Anfang/ Mitte der 1970er... Kunststoff wird modern.
In den 70er Jahren veränderten sich die Ampeln im Westen. Es tauchten die ersten Kunststoffsignalgeber auf. Designa brachte ein Signalgeber raus, der den Metallsignalgebern von den Gebrüdern Stoye sehr ähnlich sah. Bei genauer Betrachtung sieht man allerdings die feinen Unterschiede, und der Designa besteht bis auf die Schuten, aus Kunststoff. Auch Siemens kam mit einem Signalgeber aus Kunststoff raus. Ein Signalgeber, der sich bis heute gut verkauft. Der Standard Kunststoffsignalgeber. Zu der Zeit hieß das Unternehmen sogar noch Siemens & Halske.
Die Signalgeber waren mit E27 Lampenfassungen ausgestattet, so dass normal Glühlampen weiter zum Einsatz kamen. Besonderheit war, dass die Schuten der Kunststoffsignalgeber, mit den Schuten der letzten Generation der Silumin- Signalgeber kompatibel waren. So konnte man mit den Kuststoffschuten die dritte Generation der Silumin am Leben halten. Ende der 70er Jahre, bzw. Anfang der 80er Jahren, sollen dann auch die Kunststoffsignalgeber mit 10V Niedervolttechnik erhältlich gewesen sein.
Mittlerweile entwickelte sich ein Starker Konkurrenzkampf aus dieser Geschichte. Denn nicht nur Siemens produzierte einen Kunststoffsignalgeber. Auch das Unternehmen Signalbau Huber brachte einen Signalgeber auf den Markt, der der Verkaufsschlager des Unternehmens wurde, und einer der bekanntesten und beliebtesten Signalgeber in Deutschland wurde. Selbst heute ist die Nachfrage immernoch groß.
Die Rede ist von niemand geringerem, als vom Signalgebertyp "Global" von Signalbau Huber. Er ist unverwechselbar: Seine runde, kompakte Form ist auf den Straßen nur zu bekannt. Die Rahmen der Scheiben sind gleichzeitig der Rand des Signalgebers. Dahinter verbirgen sich runde Formen, die in einen schmalen, länglichen Körper übergehen. In den Rundungen waren die Reflektoren Verbaut, und nach der Einführung der Niedervolttechnik, wurde der Trafo in den Schmalen Länglichen Körper verbaut. Mann kann quasi sagen, dass das Gehäuse des Signalgebers auf des nötigste reduziert wurde. Die E27 Ausführungen sieht man heutzutage kaum noch. Eher findet man Niedervolt- Signalgeber oder LED- Signalgeber.
Auch in der DDR gab es einen neuen Signalgeber. Dieser war allerdings nicht aus Kunststoff, sondern aus Aluminium. Genauer war es ein Aluminium- Druckguss- Gehäuse, und diese Form kennen viele als "DDR- Ampel". Gefertigt wurden sie im VEB Signaltechnik Wildenfels bei Zwickau. Die damaligen E27- Signalgeber haben von der Fassung und von den Reflektoren genaue Ähnlichkeiten mit dem Ostsignalgeber der 50er Jahre, weshalb man sich sicher ist, dass es da eine Verbindung gibt. Ende der 70er Jahr, Anfang der 80er Jahre waren auch diese Signalgeber mit 10V Niedervolttechnik zu bekommen.
Ende 1960/ Anfang 1970 in Italien, und dann in Deutschland
Die Firma Siemens produzierte einen Signalgeber für Italien. Zu Anfang noch die Silumin- Signalgeber, später den Kunststoffsignalgeber. Italien hatte aber eine verrückte Vorgabe, die später in zwei westdeutschen Städten, das Stadtbild mit veränderte. Die Signalgeber sollten Gelb gefärbt sein. Für die Auffälligkeit im Straßenverkehr waren gelbe Signalgeber in Italien Standard, also mussten auch die bei Siemens bestellten Signalgeber gelb sein.
So produzierte das Unternehmen die damals aktuellen Modelle in Gelb. Aus unbekannter Ursache, stellte Italien den Kauf der gelben Signalgeber ein, und Siemens blieb auf einer Überproduktion sitzen. Aber nicht lange. Die gelben Signalgeber wurden letztendlich in zwei Städten aufgenommen: in Braunschweig und in Bremerhaven. Hunderte Anlagen wurden mit den gelben Signalgebern ausgerüstet, doch leider kamen die Nachteile schnell. Der Kuststoff ist ziemlich schlecht gewesen, weshalb die Signalgeber schnell kaputt gingen. Zu dem heißt es laut Quellen, dass der gelbe Farbstoff giftig sein soll. So wurde die Produktion eingestellt und Siemens konzentrierte sich wieder auf seine Tannengrünen und Kieselgrau- Schwarzen Signalgeber. Heutzutage findet man kaum noch eine Anlage, die mit den gelben Signalgebern ausgerüstet ist. Und wenn doch noch eine steht, ist sie nicht mehr 100%ig gelb.
1975... Einer geht, der Andere wird größer.
Designa ist mit seinem Glockensignalgeber und mit seinem Kunststoffsignalgeber gut voran gekommen. Doch 1975 war es vorbei. Die Firma Signalbau Huber übernahm das Unternehmen Designa. So stand in den ersten Jahren nach der Übernahme noch "SIGNALBAU HUBER- DESIGNA" auf den Signalgebern. Später dann verschwindete das Wort Designa völlig. Übrig geblieben sind nur noch die alten Signalgeber von ihnen.
Er kam vermutlich Ende der 80er Jahre... oder doch in den 90ern?
Die 4-Punkt Signalgeber, die damaligen Straßenbahnsignalgeber gab es sowohl in Ost, als auch in West. Dort allerdings nicht lange. In Westdeutschland wurden während der deutsch-deutschen Teilung die Balkensignale eingeführt, die heute in ganz Deutschland Standard sind. Nach Mutmaßungen, produzierte Siemens dennoch für den Westen 4-Punkt Signalgeber, die aus einem Kunststoffgehäuse bestanden, und aus Metallplatten, die auf eine ausgeschnittene Tür gebracht wurden. Durch die Abschaffung der 4-Punkt Signalgeber im Westen, blieb Siemens ähnlich wie beim gelben Kuststoffsignalgeber, auf einer Überproduktion sitzen.
Die Signalgeber waren später in bestehenden DDR- Anlagen wieder zu finden, aber nur in Berlin. Ob die Signalgeber nach während der Teilung oder erst in den 90ern, zum Erhalt der Anlagen, installiert wurden, ist nicht bekannt. Gut möglich ist es auch, dass die Signalgeber erst in den 90ern gebaut wurden, um eben bestehende Anlagen in Berlin vorerst noch am Leben zu halten. Sollte jemand Informationen zu dem Signalgeber haben, würden wir uns über eine E-Mail sehr freuen, um Klarheit in die Sache zu bringen.
1990... Wiedervereinigung... und "Tod" vieler unschuldiger Ampeln
Die Wiedervereinigung Deutschlands veränderte den Straßenverkehr in der Osthälft. Viele Anlagen wurden in den 90ern umgebaut: Die alten Ostsignalgeber kamen weg, die alten Steuergeräte wurden entfernt, und die Technik aus dem Westen kam in den Osten. Teilweise wurden auch die Maste erneuert. Siemens und Signalbau Huber hatten viel zu tun in der Zeit. War das Geld alle, oder keins da, wurden die Steuerungen verändert, so dass (auch eine große Veränderung), das Grün-Gelb- Schaltbild verschwindete. DDR- Ampeln hatten die Farbfolge: Rot; Rot-Gelb; Grün; Grün-Gelb; Gelb; Rot.
Um den aus dem Westen übernommenen Bestimmungen gerecht zu werden, wurden ab 1995 so gut wie alle 4-Punkt Straßenbahnsignalgeber entfernt, bis auf ein paar "übersehene". In Halle an der Saale, ist der Fall eingetreten, dass kein Geld für eine Anlagensanierung da war. Stattdessen wurden mehrere Kfz- Signalgeber reaktiviert und mit den Balkensymbolen ausgestattet (siehe Foto). Dafür musste selbstverständlich auch die Steuerung angepasst werden. Es soll ähnliche Fälle auch in anderen Städten gegeben haben, zum Beispiel in Zwickau.
Heutzutage findet man eigentlich keine DDR- Anlagen mehr. Die letzte in beispielsweise Dresden wurde zwischen 2002 und 2003 vom Netz genommen und gegen eine Signalbau Huber Anlage getauscht, die aber einige Jahre späte von einem Provesorium abgelöst wurde.
Eine der letzten aktiven Anlagen befand sich in Berlin, auf der Kreuzung Hauptstraße/ Rhinstraße. Diese hatte auch noch 4- Punkt Signalgeber, sogar DDR- Signalgeber und Siemens Kunststoff 4-Punkt Signalgeber im Mischbetrieb. Diese Anlage überlebte so gesehen relativ lange. Ende 2014 wurde die Sanierung der Anlage angekündigt, die im Anfang des Jahres 2015 ausgeführt wurde. Es gibt noch ein paar DDR- Anlagen in Berlin, die allerdings außer Betrieb sind, und dem Verfall ausgeliefert sind.
Natürlich sollte alles an die Westdeutschen Regelungen angepasst werden. Dies hatte auch zur Folge, dass zwei verkehrstechnische Sachen auf der "Abschussliste" standen, die den Ostdeutschen besonders wichtig geworden ist: Der Grünpfeil und das Ostampelmännchen.
In den frühen 90er Jahren verschwanden vermehrt Grüne Pfeile und Ampelmännchen, sogar in belassenen DDR- Signalgebern.
Markus Heckhausen war einer der Wichtigsten, die zur Rettung der Ampelmmännchen beigetragen hat. Er nahm die ausgebauten Ostmännchen mit, entwickelte daraus eine Wohnzimmerlampe und gründete somit das erfolgreiche Unternehmen "AMPELMANN Berlin". Nach dem auch die Bürger die Rückkehr der Ampelmännchen und des Grünpfeils forderten, wurden diese wieder zugelassen. Beispielsweise werden in Dresden seit dem Jahrtausendwechsel wieder Ostmännchen eingebaut, sogar in neue LED- Lichtsignalanlagen. Auch der Grünpfeil hat es geschafft, wieder aufzutauchen, ist aber durch Fußgänger- und Fahrradverbände wieder einmal bedroht.
Ab 2000: die Zukunft steht an....
Nach 2000 gab es abermals eine Veränderung in der Verkehrstechnik. Die Hersteller versuchten sich an LED- Modulen für den Straßenverkehr. Ihr Ziel war es, das gut Sichtbare LED- Licht in die Ampeln zu bekommen. Vorreiter waren zum Beginn Swarco mit dem FuturLED 0 bzw. 1, und Garufo. Garufo hatte große Vorteile gehabt, und war den anderen sogar um mehrere Jahre voraus. Der Hersteller entwarf Platten, so groß wie ein Streuglas, voll mit Leuchtdioden. Durch diese vielen Leuchtdioden ist Garufo eins der Langlebigsten LED´s die es für Ampeln gibt. Bis weit über 10 Jahre können diese Module halten, je nach dem, wie sehr es beansprucht wird. Und der Vorsprung? Ganz einfach: Während es bei Swarco und später auch bei Siemens noch Farbscheiben gab, verwendete Garufo schon graue Scheiben. Die verhinderte, dass bei Sonneneinstrahlung sogenannte Phantomsignale entstehen, denn die Farben erzeugen die LED´s selber. Als Garufo das Modul Dialight produzierte, wurde das Unternehmen von Siemens aufgekauft, und steckt heute quasi in jedem Silux- LED mit drin. Swarco nahm sich dem Unternehmen LumiLED an und machte daraus das FuturLED2. Schon 2005 tauchte vermehrt das Erfolgs- LED von Swarco auf: Das FuturLED3. Es setzte sich schnell durch und war auch etwas später mit grauen Scheiben erhältlich. Es gab dann auch ein kleines Make-Over, bei dem die zweite Generation des LED- Moduls entstand, namens FuturLED3R. Dafür gab es sogar neue Scheiben, bei dem die Streuung etwas feiner ist, als bei den Vorgänger Modellen.
Siemens präsentierte ihre neuste LED- Technik auf der Intertraffic Amsterdam 2016. Dabei sollen die LED- Module eine Leistungsaufnahme von nur noch 1W bis max. 2W haben. Dies soll die Anlagen noch effizienter machen. Dabei wurde das Licht etwas angepasst und neue Scheiben mit einer feineren Streuung entworfen. Beispielsweise wurde im Oktober 2017 in Dresden die erste 1W- Lichtsignalanlage in Betrieb genommen. Sie befindet sich auf der Königsbrücker Straße/ Moritzburger Weg. Mittlerweile wurden weitere Anlagen mit der 1W Technik gebaut.
2012/ 2014: ein Taster wird berühmt
Zwei Junge Menschen hatten eine Idee: das warten an der Ampel soll nicht mehr so langweilig sein. Ihre Lösung: ein Taster, auf dem man mit einem Gegner auf der anderen Straßenseite ein Spiel spielen kann. Es hieß schliecht und ergreifend: StreetPong. Die jungen Herren entwarfen einen Taster, der im Jahr 2014 in Hildesheim tatsächlich als Pilotprojekt installiert wurde. Die Langmatz GmbH präsentierte den Taster mehrmals auf der Verkehrstechnikmesse "Intertraffic" in Amsterdam.
2014: ein weiterer Taster wird berühmt
In Marl wurden im Sommer 2014 zwei Anlagen mit einem neuen Taster ausgerüstet, und der konnte etwas ganz besonderes. Das Gerät namens Crossguide des Herstellers Langmatz konnte sprechen.
Der Hintergrund: die Tochter eines Vertreters bei Langmatz begleitete ihren Vater auf arbeit, und interessierete sich für seine Arbeit. Als der Vater zeigte, an welchem Gerät er arbeitete, und was man damit alles machen kann, kamen die beiden auf eine Idee. Sie nahmen die Stimme der Tochter auf und spielte diese auf den Taster ein. Kurz darauf war die Idee der "sprechenden Ampel" geboren.
Im Sommer 2014 wurden dann die zwei Pilotanalagen eingerichtet. Seit dem ertönt bei jeder Anforderung der Satz "Dankeschön, Gleich wird´s grün". Es gab viel Begeisterung und Interesse. Auch die Presse berichtete lüber die "sprechende Ampel". Mittlerweile war diese Art auch in anderen Städten gefragt.
2015: eine Idee aus Wien sorgte für Wirbel in der Presse
Im Jahre 2015 wurden drei neue Fußgängersymbole entworfen und ausgeführt, die für viel Gesprächsstoff sorgten. Entwurfen wurden sie für den Eurovision Songcontest, der durch die Gewinnerin Conchita Wurst im Jahre 2014, in Wien stattfinden sollte. Auf den drei neuen Symbolen wurden drei Paare abgebildet: ein Heterosexuelles Paar, ein lebisches Paar, und ein schwules Paar. Diese sollten für mehr Tolleranz stehen. Sie fanden viel Begeisterung und erhielten kurzfristig Zulassungen (manche auf Zeit) in Salzburg, München, Hamburg, Flensburg und sogar in weiteren europäischen Ländern, wie zum Beispiel die Niederlande. Sie erhielten den Namen "Wiener Ampelpärchen". Doch so viel Begeisterung die Ampelpärchen auch erhielten, soviel Kritik und auch Hass kam gegen die Symbole aus Österreich auf. So wurden diese Symbole beispielsweise in der Satieresendung "extra3" verhöhnt und als "Realsatiere" schlecht geredet. Die Meinungen gehen stark auseinander. Viele Politiker beantragten die Abschaffung der Symbole, sogar in Wien. Ob und wo die Symbole wirklich wieder abgeschafft wurden, ist unklar.